Ein Gastbeitrag von Erik Lemke
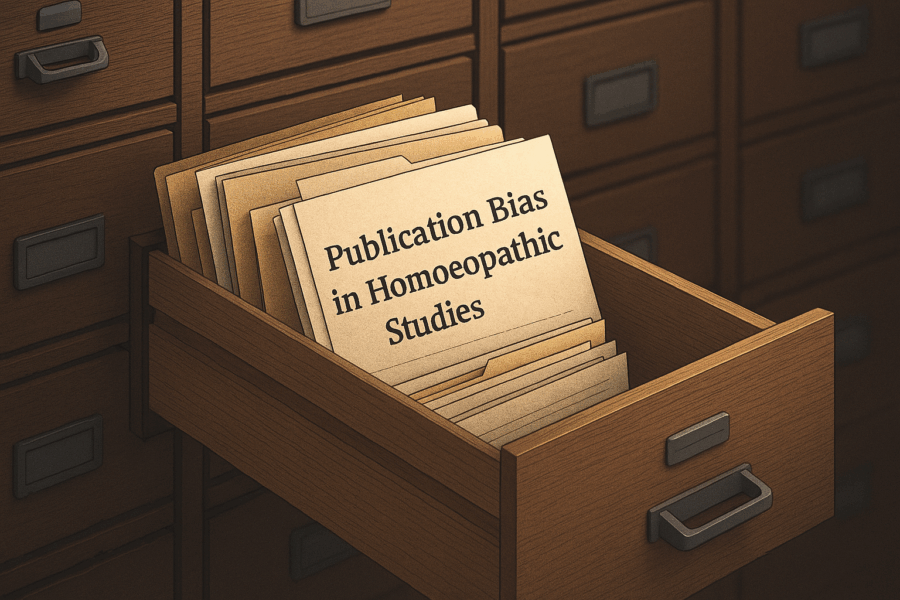
2022 zeigte eine vielbeachtete Analyse von Gerald Gartlehner et al. (Donau-Universität Krems, Österreich) im British Medical Journal (The BMJ) deutliche Verzerrungen bei homöopathischen Studien.[1] Die Arbeit untersuchte, wie viele Studien seit 2002 registriert und publiziert und ob die Hauptziele (der zentrale Untersuchungsgegenstand, main outcome) nachträglich verändert wurden – und fand erhebliche Defizite bei wissenschaftlichen und ethischen Standards. Rund 38 % der registrierten Studien wurden nie publiziert, rund 50 % waren gar nicht registriert, und unregistrierte Arbeiten berichteten deutlich höhere Effekte – ein klares Zeichen für Reporting-Bias.
Das Homeopathy Research Institute (HRI) reagierte prompt und betonte, dass ein solcher Bias in allen Bereichen der Medizin vorkomme, die Homöopathie aber sogar geringere Verzerrungen zeige als die konventionelle Forschung – für das HRI gar ein Hinweis auf überdurchschnittliche wissenschaftliche Standards.[2] Die Argumente waren jedoch wenig überzeugend, teils sogar irreführend, sodass sie außerhalb der homöopathischen Echokammer kaum Resonanz fanden. Dennoch ist es wichtig, die Strategien des HRI transparent zu machen, um deutlich zu zeigen: Es handelt sich nicht um neutrale Studienkritik, sondern um interessengeleitete Lobby-Kommentare.
Drei Phasen der Gegenwehr
Das Vorgehen der Homöopathie-Szene lässt sich in drei Phasen gliedern: Bereits einen Tag nach der Veröffentlichung lieferte das HRI einen Kommentar mit vorformulierten Argumentationshilfen. Innerhalb einer Woche tauchten diese Argumente – teils nahezu identisch, teils ergänzt – in Rapid Responses auf der Website von The BMJ auf, unterzeichnet von Autoren aus der Homöopathie-Szene.[3] Die Redaktion des British Medical Journals kuratiert Rapid Responses nicht, es findet weder Peer Review noch Qualitätskontrolle statt. Es ist eine Art „Pinnwand“ für spontane Kommentare zu Neuveröffentlichungen.
In einer dritten Phase nutzten homöopathische Fachverbände sowohl den HRI-Kommentar als auch die Rapid Responses als Grundlage für eigene Artikel. Für deren Leserschaft war die Kernaussage der Gartlehner-Analyse kaum mehr erkennbar, da sie nur am Rande erwähnt und der Fokus ganz auf die Behauptungen des HRI verschoben wurde. Zudem entstand leicht der Eindruck, führende Homöopathen hätten ihre Texte offiziell im BMJ publiziert, obwohl es sich lediglich um eine frei zugängliche Kommentarfunktion handelte.[4]
Auch die sogenannte Wissenschaftliche Gesellschaft für Homöopathie (WissHom) griff diese Darstellungen unkritisch auf[5] – ein Vorgehen, das in deutlichem Widerspruch zu ihrem eigenen Anspruch steht, wissenschaftlichen Standards zu genügen.
Äpfel und Birnen: Scheinvergleiche
Wie argumentierte das HRI konkret? Gartlehner et al. zeigen, dass etwa 38 % der registrierten randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) zur Homöopathie unveröffentlicht blieben, während rund 50 % der Studien überhaupt nicht registriert waren.[6] Um die 38 % unveröffentlichter Homöopathie-Studien schönzureden, stellte das HRI einen unzulässigen Vergleich an: Es hob hervor, dass „62 % aller registrierten Homöopathie-Studien veröffentlicht werden“, und stellte dem gegenüber, in der konventionellen Medizin melde „nur die Hälfte“ aller registrierten klinischen Studien ihre Ergebnisse innerhalb von 12 Monaten.
Für diese Zahl griff das HRI auf eine andere BMJ-Analyse zurück, in der die Einhaltung der Ergebnisberichtsfristen im EU Clinical Trials Register untersucht wurde.[7] Dabei werden aber Äpfel mit Birnen verglichen. Für Homöopathie zählt jede spätere Veröffentlichung, für konventionelle Studien nur die fristgerechte Meldung im EU-Register. Dadurch entsteht der Eindruck, Homöopathie sei besonders pflichtbewusst. Korrekt wäre es gewesen, denselben Maßstab auf beide Gruppen von RCTs anzuwenden.
Outcome Switching – verschleiert statt erklärt
Ein weiteres Argument des HRI lautet: „Inkonsistenzen in der Berichterstattung über den primären Wirksamkeitsendpunkt treten bei 43 % der schulmedizinischen Studien auf, während dies nur bei 25 % der veröffentlichten Homöopathie-Studien der Fall ist.“ Dieser Wert von 43 % stammt ebenfalls nicht aus der Analyse von Gartlehner et al. und ist für einen direkten Vergleich ungeeignet. Gartlehner et al. berichten, dass Homöopathie-Studien überwiegend nachträglich registriert wurden.[8] Bei nachträglicher Registrierung können Forscher die primären Endpunkte (also die Definition dessen, was überhaupt genau untersucht werden soll) den bereits bekannten Daten anpassen und Studien ohne gewünschte Ergebnisse einfach außer Acht lassen – Inkonsistenzen verschwinden so aus der Statistik. „Outcome Switching“ gilt als unethisch. Entsprechend ist nicht zu erwarten, dass Forscher dies freiwillig offenlegen.
Die 43 % von Shah et al. beruhen auf registrierten Studien in Cochrane-Reviews[9], die überwiegend prospektiv registriert gewesen sein dürften, insbesondere wenn sie regulatorischen Anforderungen unterlagen. Die 25 % von Gartlehner et al. stammen dagegen aus einem Korpus, in dem die meisten Studien erst nachträglich registriert wurden. Ob sich Outcome-Switching bei nachträglich registrierten Studien überhaupt sinnvoll untersuchen lässt, wäre eine berechtigte Frage – doch an solchen Diskussionen zeigt das HRI kein Interesse.
Der Hauptbefund wird verdreht
Um die potenziellen Auswirkungen durch den Publication Bias zu veranschaulichen, werteten Gartlehner et al. eine von Homöopathen oft zitierte Meta-Analyse von Mathie et al. (2017) erneut aus. Berücksichtigt man darin nur registrierte Studien, verschwindet der scheinbar signifikante Vorteil der Homöopathie gegenüber Placebo.[10]
Gartlehner et al. schlussfolgern aus ihren Ergebnissen: „Dies beeinträchtigt wahrscheinlich die Aussagekraft der in der homöopathischen Literatur enthaltenen Belege und kann zu einer Überschätzung der tatsächlichen Behandlungswirkung homöopathischer Mittel führen.“[11]
Statt sich mit diesem Befund auseinanderzusetzen, verzerrte das HRI die Aussage von Gartlehner et al. und zitierte selektiv: „Der Unterschied in den Effektgrößen zwischen registrierten und nicht registrierten Studien erreichte keine statistische Signifikanz.“[12]
Dieser Satz bezieht sich lediglich auf eine Meta-Regression – eine Zusatzanalyse, die untersucht, ob andere Faktoren (z. B. Studiendesign oder Stichprobengröße) den beobachteten Unterschied erklären könnten. Am Hauptbefund – dass registrierte und nicht registrierte Studien sich signifikant in ihren Effektgrößen unterscheiden – ändert dies nichts.
Gartlehner et al. zeigen mit der Meta-Regression, dass unregistrierte Studien auch in weiteren Qualitätskriterien systematisch schlechter sind. Die Meta-Regression dient ausdrücklich dazu, einer verkürzten Interpretation vorzubeugen, nicht um den Kernbefund zu relativieren. Wenn das HRI diesen methodischen Nebenaspekt in den Vordergrund rückt und den eigentlichen Befund verschweigt, scheint es sich nicht an Fachwissenschaftler zu wenden, die den methodischen Fehlgriff sofort bemerken würden, sondern eher an fachfremde Leser.
Warum das alles schwerer wiegt als in der „Schulmedizin“
Der Verweis des HRI auf Missstände in der konventionellen Medizin ist klassischer Whataboutism – und dennoch nicht ganz falsch. Entscheidend fehlt jedoch das Eingeständnis, warum solche Missstände bei Homöopathie-Studien besonders schwer wiegen. Gartlehner et al. bringen es klar auf den Punkt: „Für die Zulassung pharmazeutischer Behandlungen muss die Industrie sämtliche Studiendaten den Zulassungsbehörden vorlegen, unabhängig von der Veröffentlichung in der medizinischen Fachliteratur. Die Homöopathie ist jedoch von den meisten regulatorischen Anforderungen ausgenommen. Dies hat zur Folge, dass keine unabhängige Zulassungsbehörde individuelle Patientendaten aus Studien überprüft, statistische Analysemethoden bewertet oder Langzeitdaten anfordert. Jede Beurteilungder Wirksamkeit homöopathischer Behandlungen muss sich daher ausschließlich auf veröffentlichte Belege stützen.“[13]
Mit anderen Worten: Während bei konventionellen Arzneien ein Sicherheitsnetz aus verpflichtender Datenoffenlegung existiert, fällt dieses bei homöopathischen Mitteln weg.
Ohne ein institutionelles Korrektiv wiegen selektive Berichte, geschönte Endpunkte und unveröffentlichte Studien deutlich schwerer.
Erik Lemke
05. September 2025
Anhang INH: Wozu dienen Homöopathie-Studien eigentlich?
Bei aller Detailkritik lohnt es sich, das Grundproblem im Blick zu behalten: Studien haben für die Homöopathie eine ganz andere Funktion als in der Wissenschaft üblich. Insbesondere ist seit jeher zu beobachten, dass sie keinerlei Einfluss auf die homöopathische Praxis haben.
Für die naturwissenschaftliche Medizin sind Studien das zentrale Instrument, um Wirksamkeit und Sicherheit von Verfahren nachprüfbar zu belegen. Für die Homöopathie dagegen gilt nach wie vor das Credo: „Alles Wesentliche hat Hahnemann bereits aufgeschrieben.“ Wer mehr wissen will, dem wird auf die „unzähligen erfolgreichen Anwendungen weltweit“ verwiesen. Der echte Homöopath ist daher auf Studien gar nicht angewiesen, zumal bereits Hahnemann schrieb, dass er der Frage, wie seine Methode wissenschaftlich erklärbar sei „keinen großen Werth beimesse“.
Warum also trotzdem die Mühe? Zwei Gründe stechen hervor:
- Reputation – Man möchte nach außen hin den Anschein einer „wissenschaftlichen“ Disziplin wahren. Studien sind dazu eine unverzichtbare Requisite.
- Selbstvergewisserung – Innerhalb der Homöopathie-Community dienen Studien als Beleg dafür, dass man mit den „richtigen Methoden“ auf Augenhöhe mit der Wissenschaft agiere.
Das erklärt auch, warum das HRI auf die Analyse von Gartlehner et al. so hektisch reagierte: Wird der „body of evidence“ systemisch in Frage gestellt, bricht der Szene die wichtigste Währung im Ringen um Anerkennung weg.
Dabei sind die Zahlenspielereien und Vergleichsstatistiken, mit denen das HRI operiert, wissenschaftlich belanglos. Evidenz entsteht nicht durch das Abzählen von Parametern, sondern durch die Gesamtschau hochwertiger, methodisch solider Studien. Genau daran mangelt es der Homöopathie.
[1] Gartlehner G, et al. Assessment of Bias in Randomized Clinical Trials of Homeopathy: A Meta-epidemiological Study. BMJ Evidence-Based Medicine. 2022;27(6):345-351.
[2] HRI-Kommentar zum BMJ-Artikel online unter: https://www.hri-research.org/de/2022/03/hri-kommentar-zum-bmj-artikel-ueber-berichtsverzerrung-reporting-bias-von-homoeopathie-studien/
[3] Rapid Responses auf der Website des BMJ-Journals, (veröffentlicht 21./24.03.2022, siehe Internet Archive): https://ebm.bmj.com/content/27/6/345.responses#plausibility-bias-
[4] Nach den gezielten Umdeutungen von HRI und Co. erreichen die Inhalte die Homöopathie-Community nur noch in einer gefilterten Version. Hier z. B. über die Website der Österreichischen Gesellschaft für Veterinärmedizinische Homöopathie: https://www.oegvh.at/eine-uebersicht-alle-artikel-rund-um-berichtsverzerrung-reporting-bias-von-homoeopathie-studien/ Zitat: „Das British Medical Journal (BMJ) hat diesen rapid response von Michael Frass und Menachem Oberbaum veröffentlicht.“ – So formuliert wirkt es für Laien, als hätten die beiden Homöopathen ein hohes Publikationsprivileg erhalten – tatsächlich handelt es sich nur um einen unbegutachteten Online-Kommentar.
[5] kritiklose Übernahme der Spin-Dokumente durch die WissHom: https://www.wisshom.de/reporting-bias-von-homoeopathie-studien/
[6] Grundsätzlich wird international eine Verpflichtung angestrebt, zu jeder Vorabregistrierung von Studien ein Endergebnis in der Registrierungsdatenbank zu veröffentlichen, gleich ob vollendete Studie oder Abbruch. Das würde das Problem des Publication Bias erheblich verringern. Dies scheint allerdings schwer erreichbar zu sein. Im Vereinigten Königreich sind die Unversitäten durch das Science and Technology Committee des House of Commons 2019 zu einer solchen Verfahrensweise verpflichtet worden – bisher die weltweit einzige institutionelle Verbindlichkeit zu diesem Problem.
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmsctech/1480/148005.htm
[7] Goldacre B, DeVito NJ, Heneghan C et al. Compliance with requirement to report results on the EU Clinical Trials Register: cohort study and web resource. BMJ 2018;362:k3218.
[8] Gartlehner 2022. → „A retrospective registration was more frequent than a prospective registration“.
[9] Shah K, et al. Assessment of Selective Outcome Reporting in Cochrane Reviews of Randomized Clinical Trials. JAMA Network Open. 2020;3(3):e200709.
[10] Gartlehner 2022. → „By contrast, a meta-analysis of registered RCTs did not show a statistically significant difference between homeopathy and placebo (SMD: −0.14, 95% CI −0.35 to 0.07).“
[11] Gartlehner 2022. → „This likely affects the validity of the body of evidence of homeopathic literature and may overestimate the true treatment effect of homeopathic remedies.“
[12] Gartlehner 2022. → korrekt zitiert lautet der Satz in Wirklichkeit: „Meta-regression revealed that the difference in effect sizes between registered and unregistered studies did not reach statistical significance.“
[13] Gartlehner et al. 2022 → „For the approval of pharmaceutical interventions, however, the industry is required to submit all trial data to regulatory agencies, regardless of the publication in the medical literature. Homeopathy, however, is exempt from most regulatory requirements with the consequence that no independent regulatory agency reviews individual patient data of trials, assesses statistical analyses methods or requests long-term follow-up data. Any assessment of the effectiveness of homeopathic treatments, therefore, must rely only on published evidence.“


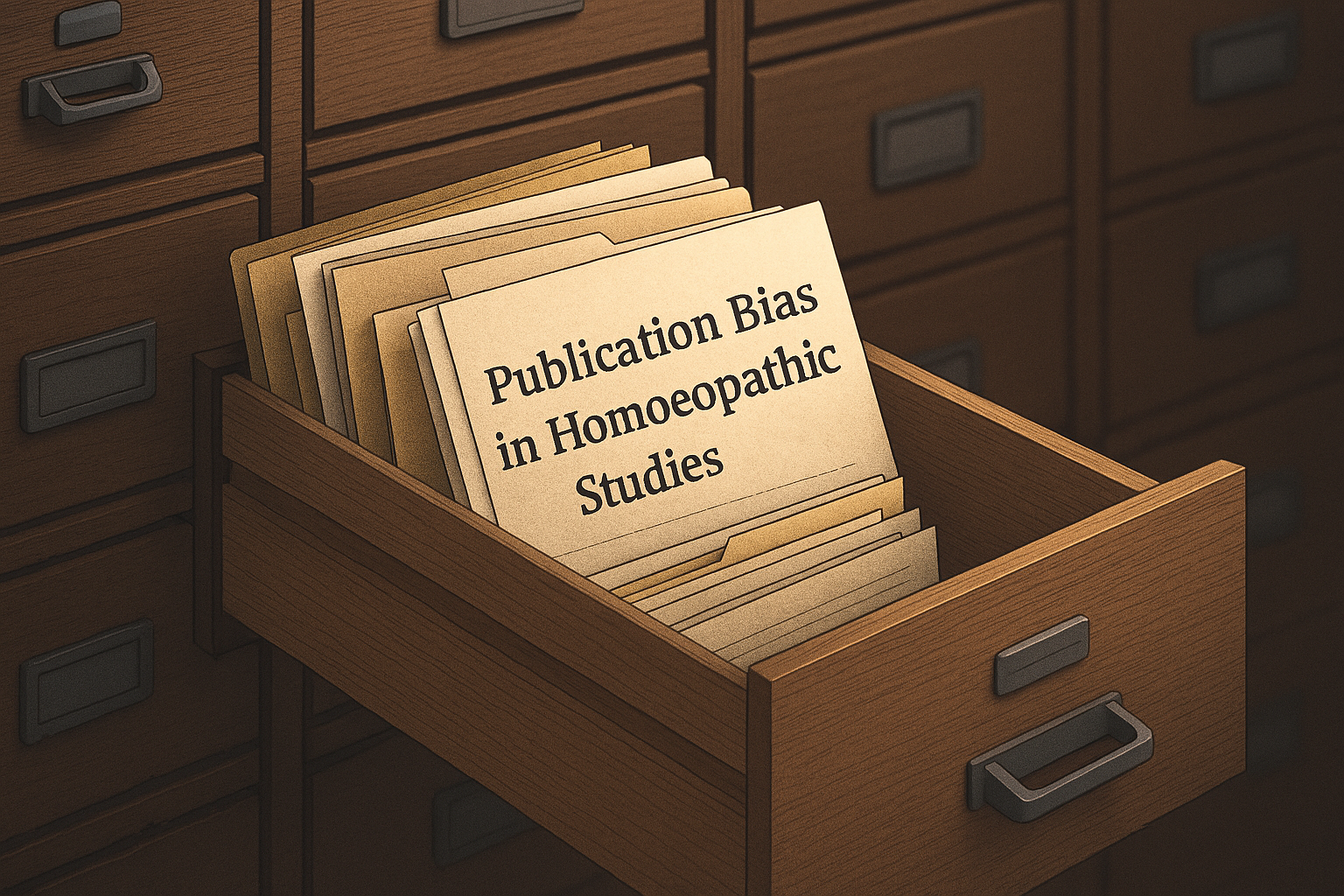
Eine Antwort auf „Publication Bias in Homöopathie-Studien – Wie das HRI die Analyse von Gartlehner et al. verzerrt“
Die Kommentare sind geschlossen.