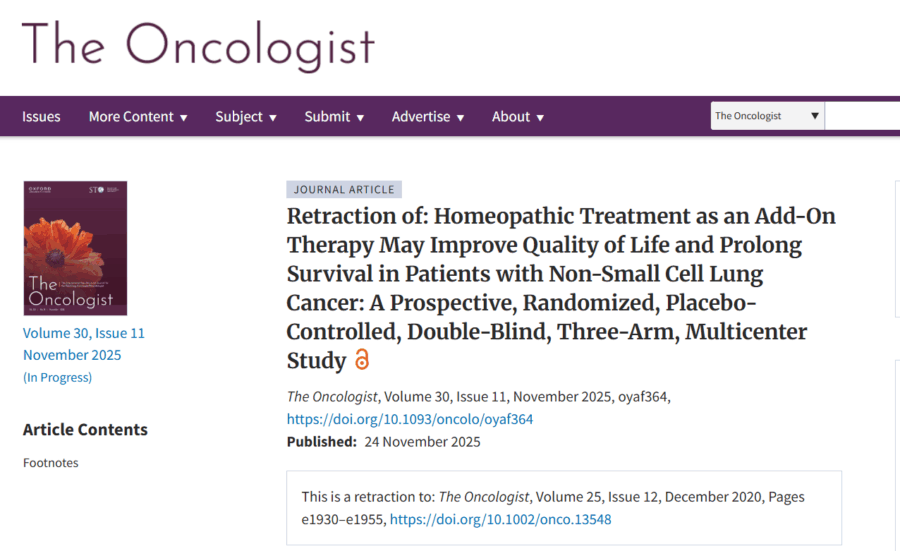
Mit dem 24. November 2025 endet einer der längsten und komplexesten wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, die das Themenfeld Homöopathie in den letzten Jahrzehnten gesehen hat:
The Oncologist hat die Studie von Frass et al. (2020) vollständig zurückgezogen:
https://academic.oup.com/oncolo/article/30/11/oyaf364/8340391
Bemerkenswert ist dabei nicht nur die Retraktion selbst, sondern der Weg dorthin – ein Weg, der wahrlich nicht von konstruktiver Kooperation mit dem veröffentlichenden Journal geprägt war, sondern von Beharrlichkeit und konsequenter Integritätsarbeit.
1. Ausgangspunkt: INH und IWM legen die Probleme offen
Kurz nach Veröffentlichung der Studie im Jahr 2020 zeigte eine Arbeitsgruppe von INH und IWM (Initiative wissenschaftliche Medizin, Österreich) gravierende wissenschaftliche Mängel der veröffentlichten Studie auf:
- widersprüchliche Angaben im Studienprotokoll
- verspätete Registrierung
- nachträgliche Protokolländerungen
- fragwürdige Randomisierung
- unplausible statistische Muster
- unzureichend dokumentierte Dropouts
- keine belastbare Datenverfügbarkeit
Diese Kritik wurde in mehreren Artikeln, Blogserien und Fachaufsätzen dokumentiert und fand bundesweit sowie international Beachtung.
2. Die entscheidende Phase: MedUni Wien und ÖAWI
Aufgruind der Feststellungen von INH und IWM übernahm die Medizinische Universität Wien die Prüfung der Studie und zog die Österreichische Agentur für wissenschaftliche Integrität (ÖAWI) hinzu. Die dortigen Ermittlungen bestätigten alle zuvor veröffentlichten Kritikpunkte – unabhängig und umfassend. Die Vorwürfe konnten sogar noch erweitert und verfestigt werden, da die ÖAWI Zugriff auf erweiterte Studiendaten hatte.
3. Die Rolle des Oncologist: Verzögerung statt Aufklärung
Für die historische Einordnung wichtig:
The Oncologist hat sich in diesem Verfahren nicht als konstruktiver Partner erwiesen, auch nicht, als es immerhin zu einer “Expression of concern” kam, die aber lange Zeit folgenlos blieb.
- Das Editorial Board der Zeitschrift reagierte mehrfach verspätet und irgendwann gar nicht mehr. Es war notwendig, die Herausgeberschaft des Journals, Oxford University Press (OUP) einzuschalten.
- Die sogenannte „zweite Korrektur“ war inhaltlich unzureichend, weil sie die Beanstandungen überhaupt nicht adressierte. Ein begleitendes Editorial dazu verharmloste die Kritikpunkte und zeigte eklatante Unkenntnis der Studiendetails.
Dass es dennoch zur Retraktion kam, ist kein Verdienst des Journals, sondern ausschließlich der Beharrlichkeit und Kompetenz von MedUni Wien, ÖAWI und der INH/IWM-Arbeitsgruppe. Diese Beteiligten hatten auch COPE (Committee on Publication Ethics), eingebunden, die eigene Integritätsstelle der medizinischen Fachjournale.
The Oncologist hat letztlich nur das getan, was nach den Integritätsbefunden nicht mehr zu vermeiden war.
4. Bedeutung der Retraktion
Mit dem Rückzug der Studie entfällt die wichtigste klinische Publikation der homöopathischen Szene seit Jahrzehnten. Sie galt lange Zeit als „Leuchtturm“ der Homöopathie und wurde trotz der Kritik bis zuletzt in Vorträgen und Medien als ultimativer Wirksamkeitsnachweis präsentiert.
Die Faktenlage ist nun eindeutig:
- Die Studie ist wissenschaftlich nicht haltbar.
- Die behaupteten Effekte sind nicht belegt.
- Die Publikation darf nicht länger zitiert werden.
- Sie ist nicht Bestandteil wissenschaftlicher Evidenz.
Damit verliert die Homöopathie ihr wohl wichtigstes modernes klinisches Aushängeschild.
5. Fazit: Ein Sieg wissenschaftlicher Integrität
Dieser Retract ist ein beispielhafter Fall dafür, wie wissenschaftliche Selbstkorrektur funktionieren kann – selbst dann, wenn einzelne Akteure im Prozess diese Selbstkorrektur zu verhindern versuchen. Gleichzeitig hat sich diese Sache zu einem bemerkenswerten Lehrstück zum Thema der Integrität wissenschaftlicher Publikation entwickelt.
Der Fall zeigt:
- Wissenschaftliche Qualität braucht unabhängige Prüfinstanzen.
- Beharrliche, gut dokumentierte Kritik ist unverzichtbar.
- Nichtakademische Initiativen können eine zentrale Rolle spielen.
- Universitäten und Integritätsstellen können Fehlentwicklungen korrigieren, wenn sie handeln.
- Und am Ende setzt sich die Evidenz – manchmal spät – doch durch.
Für INH und IWM bedeutet der Fall Frass 2020–2025:
Fast fünf Jahre sorgfältiger Arbeit haben zu einem wichtigen Ergebnis geführt.
Eine zentrale Pseudoevidenz für die Homöopathie existiert nicht mehr.
Die komplette Chronologie der Ereignisse einschließlich des tagesaktuellen Standes:
https://www.initiative-wissenschaftliche-medizin.at/index.php?id=240
Die Artikel beim INH zu den Feststellungen von INH und IWM:
https://netzwerk-homoeopathie.info/category/studienkritik-frass-et-al-2020
Artikel von Norbert Aust und Viktor Weisshäupl im Skeptiker und im Skeptical Inquirer:
Skeptiker 4/2022, Seiten 177 – 184
https://skepticalinquirer.org/2023/05/homeopathy-research-hits-new-low
Skeptiker-Artikel mit dem Sachstand vom Frühjahr (Mai 2025):
https://www.gwup.org/skeptiker-artikel/komplementaer-und-alternativmedizin-cam/dass-doch-sein-darf-was-nicht-sein-kann


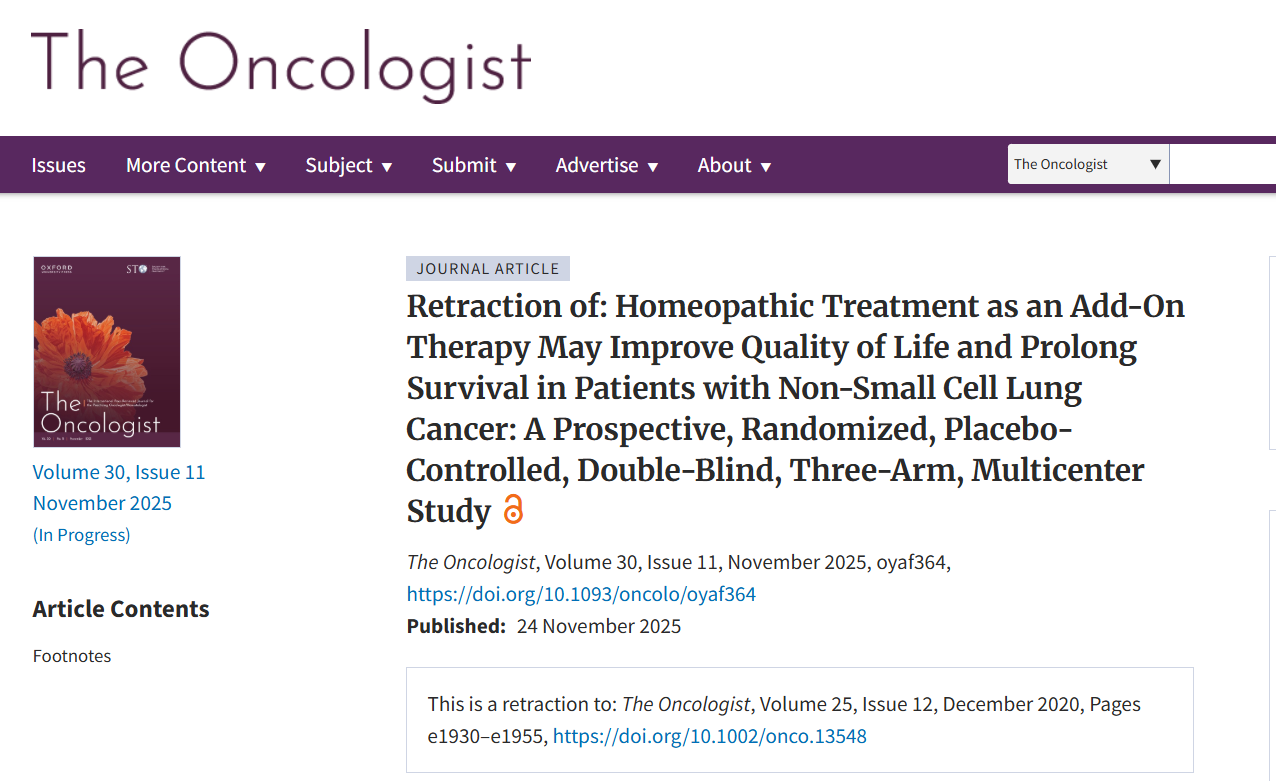
4 Replies to “Die Retraktion der Frass-Studie (2020): Abschluss und Einordnung eines langen, schwierigen Prozesses”
Comments are closed.